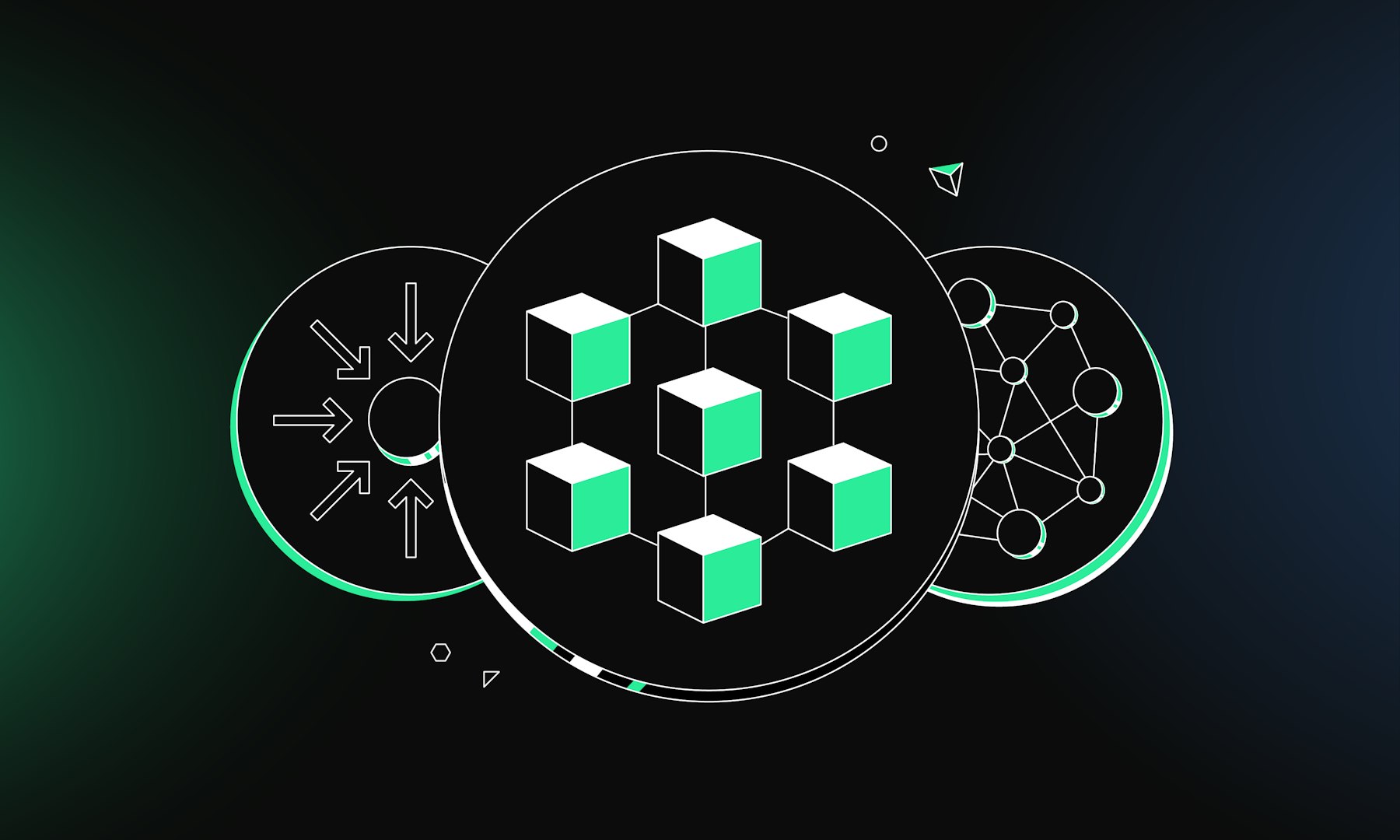Wer hat das Internet eigentlich erfunden?
Das Internet, wie wir es heute kennen, begann nicht mit Social Media oder Online-Shopping. Es entstand Jahrzehnte früher – als Projekt der USA zur Zeit des Kalten Krieges. Ziel war es, ein Kommunikationssystem zu entwickeln, das auch einen Atomschlag überstehen könnte. Damals waren Computer riesig, teuer und wurden fast ausschließlich militärisch oder akademisch genutzt.
Ende der 1960er entwickelte die US-Behörde ARPA (Advanced Research Projects Agency) das erste Netzwerk, das mehrere Computer verband: ARPANET. Es war ein Durchbruch – und die Grundlage für das heutige Internet. Oft wird gefragt, wer das Internet erfunden hat. Die Antwort: Es war keine einzelne Person, sondern ein gemeinschaftlicher Fortschritt über viele Jahre hinweg.
Ein großer Meilenstein folgte 1989, als Tim Berners-Lee eine neue Ebene zum Internet hinzufügte: das World Wide Web. Er erfand nicht das Internet selbst, sondern ein System, mit dem es sich einfacher nutzen ließ. Mithilfe von Hyperlinks, einer gemeinsamen Sprache (HTML) und einem Protokoll (HTTP) wurde es möglich, Webseiten zu erstellen, zu verlinken und zu lesen. Dazu entwickelte er den ersten Webbrowser – und machte das Internet für alle zugänglich.
Diese Entwicklung verwandelte ein technisches Netzwerk in einen öffentlich nutzbaren Raum. Damit war der Weg frei für Web1: die erste Version des Internets für die breite Öffentlichkeit.
Web1: das statische Web (1990er – frühe 2000er)
Die erste Phase des Internets – oft Web1 oder Internet 1.0 genannt – war einfach, aber revolutionär. In dieser Zeit war das Web vor allem zum Lesen da: Nutzer konnten Informationen abrufen, aber nicht selbst aktiv werden. Webseiten waren wie digitale Broschüren – mit Text, Bildern und wenig Funktionalität.
Grundprinzipien von Web1:
Web1 war geprägt durch:
Statische Webseiten: Inhalte waren fest und konnten nicht verändert werden
Dezentrale Struktur: Webseiten lagen auf einzelnen Servern, nicht bei großen Konzernen.
Einfache Technologie: Technische Einschränkungen begrenzten Dynamik und Geschwindigkeit. HTML war Standard.
Keine sozialen Funktionen: Nutzer konnten Inhalte weder kommentieren noch teilen oder untereinander kommunizieren.
Die Dotcom-Blase und der Aufstieg von Web2
Mit dem Start von Web1 wuchs die Begeisterung fürs Internet rasant. Ende der 1990er glaubten viele Investoren an einen radikalen Umbruch der Weltwirtschaft. Es folgte ein Investitionsboom in Online-Geschäftsmodelle – die Zeit der sogenannten “Dotcom-Blase”.
Viele dieser Startups hatten kaum tragfähige Ideen, erhielten aber dennoch Millionen an Risikokapital. Aktienkurse stiegen stark an, obwohl viele Firmen wirtschaftlich kaum auf festen Beinen standen. Anfang der 2000er platzte die Blase – viele Unternehmen verschwanden, Investoren erlitten hohe Verluste.
Trotzdem war diese Phase ein Wendepunkt. Sie lenkte den Fokus auf robustere Geschäftsmodelle. In der Folge entstanden Plattformen wie Google, Amazon und Facebook – mit klareren Strategien und skalierbaren Technologien.
Web2 war geboren: ein interaktives Internet, in dem Nutzer Inhalte nicht nur lesen, sondern auch erstellen und teilen konnten.
Web2: das soziale und interaktive Web (ab Mitte der 2000er)
Web2 – auch als “soziales Web” bekannt – verwandelte das Internet in eine Plattform für Austausch, Zusammenarbeit und digitale Märkte. Social Media, Cloud Computing und Online-Marktplätze ermöglichten es, Inhalte einfach zu erstellen und zu verbreiten.
Die Veröffentlichung wurde demokratisiert: Jeder konnte nun online sichtbar werden. Die Macht verschob sich von klassischen Medien hin zu den Nutzern selbst.
Grundprinzipien von Web2:
Web2 brachte mehrere wichtige Veränderungen:
Nutzergenerierte Inhalte: Blogs, soziale Netzwerke, Video-Plattformen und Foren boomten
Plattformgesteuerte Nutzung: Zentralisierte Unternehmen wie Facebook, Google und Amazon dominierten den Markt – oft im Tausch gegen Nutzerdaten
Datenmonetarisierung: Unternehmen sammelten, analysierten und verwerteten Daten – das weckte Datenschutzbedenken
Skalierbarkeit und Zugänglichkeit: Cloud Computing machte Dienste überall und jederzeit verfügbar
Moderne Webtechnologien: HTML5, CSS3, JavaScript-Frameworks und AJAX sorgten für dynamische, reaktionsschnelle Websites
Trotz vieler Vorteile brachte Web2 auch neue Probleme. Die Macht verlagerte sich in die Hände weniger Konzerne, die große Mengen persönlicher Daten kontrollieren. Genau hier setzt Web3 an – mit dem Ziel, die Kontrolle zurück zu den Nutzern zu bringen.
Web3: das dezentrale Web (im Aufbau)
Web3 steht für die nächste Stufe des Internets. Mit Blockchain-Technologie will es Dezentralisierung, Sicherheit und Nutzerkontrolle stärken. Anders als Web2, das von großen Plattformen geprägt ist, setzt Web3 auf ein Internet, das ohne Zwischeninstanzen funktioniert.
Digitale Identitäten und Assets gehören den Nutzern – nicht den Plattformen. Smart Contracts ermöglichen direkte und sichere Interaktionen ohne Mittelsmänner.
Grundprinzipien von Web3:
Willst du einen einfachen Einstieg in Web3? In unserem Video erfährst du, wie Dezentralisierung und digitaler Besitz Interaktionen das Internet verändern.